Die Heilmittel-Richtlinie regelt die Heilmittelverordnung, also die Versorgung der Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung mit Heilmitteln im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung (die Verordnung kurortspezifischer bzw. ortsspezifischer Heilmittel unterliegt ausdrücklich nicht den Heilmittel-Richtlinien).
Vor der Heilmittelverordnung muss sich der Arzt unter Einbezug entsprechender Diagnostik vom Zustand des Patienten überzeugen und diesen dokumentieren.
Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit ist zu beachten. Deshalb gilt es, vor der Verordnung abzuwägen, ob z. B. durch Hilfsmittel, Arzneimittel oder eigenverantwortliche Maßnahmen des Patienten die Therapieziele qualitativ gleichwertig und kostengünstiger erreicht werden können. Ist dies nicht der Fall, sind Heilmittel verordnungsfähig.
Die Verordnung von Heilmitteln ist auf einem speziellen Verordnungsvordruck vorzunehmen.
Inhaltsübersicht
Der Heilmittelkatalog
Wesentlicher Bestandteil der Heilmittel-Richtlinie ist der Heilmittelkatalog. Er beschreibt, welche Heilmittel in welchen Mengen bei welchen Diagnosen (Diagnosegruppen) im Verordnungsfall zu einer medizinisch angemessenen und wirtschaftlichen Versorgung führen.
Der Heilmittelkatalog gilt als Leitfaden zur Verordnung. Die durch den Katalog vorgegebenen Heilmittel und verordnungsfähigen Mengen basieren auf Erfahrungswerten aus der Praxis.
Schritte zur Heilmittelverordnung
Der Heilmittelkatalog ist in Diagnosegruppen untergliedert. Im vorliegenden Buch wird diese Zuordnung durch ein zweistufiges Register erleichtert. Der Verordner schlägt in einem ersten Schritt nach, welcher Diagnosegruppe des Kataloges die von ihm im Einzelfall gestellte Diagnose zuzuordnen ist.
Im zweiten Schritt zur Verordnung prüft der Verordner, welche Leitsymptomatik im Einzelfall vorliegt. Es sind außerdem mehrere unterschiedliche Leitsymptomatiken buchstabenkodiert oder als Klartext auf der Verordnung möglich. Alternativ ist auch eine patientenindividuelle Leitsymptomatik als Freitext möglich.
Die Heilmittel
Die bisherige Regelfall-Systematik, das heißt die Erst- und Folgeverordnung sowie die Verordnung außerhalb des Regelfalls, wird durch nur noch einen Verordnungsfall inklusive der orientierenden Behandlungsmenge (früher: Gesamtverordnungsmenge) ersetzt. Die Verordnungsmenge je Diagnose wird durch die Höchstmenge je Verordnung ersetzt.
Ohne Regelfall gibt es zukünftig natürlich auch keine Verordnungen außerhalb des Regelfalls mehr. Die umfangreichen Regelungen sowie das Genehmigungsverfahren sind mit dem 01.10.2020 ersatzlos gestrichen.
Bleibt die Frage, wie Patienten zukünftig versorgt werden, wenn die „orientierende Behandlungsmenge“ ausgeschöpft wurde. In diesem Fall gibt es auch weiterhin die Möglichkeit, Heilmittel aus medizinischen Gründen zu verordnen. Die medizinische Begründung muss nicht mehr auf der Verordnung angegeben, sondern lediglich vom Arzt in der Patientenakte dokumentiert werden. Dabei darf die Höchstmenge je Verordnung (in der Regel sechs bis zehn Einheiten) auch zukünftig nicht überschritten werden. Ausnahmen gelten bei langfristigem Heilmittelbedarf oder bei besonderen Verordnungsbedarfen.
Der Heilmittelkatalog gibt Auskunft darüber, mit welchen Heilmitteln in welcher orientierenden Behandlungsmenge bzw. Höchstmenge je Verordnung die Therapieziele im Verordnungsfall zu erreichen sind.
Es muss nur noch zwischen vorrangigem und ergänzendem Heilmittel unterschieden werden, da die optionalen Heilmittel in die vorrangigen Heilmittel integriert wurden.
Liegen komplexe Schädigungsbilder vor, für deren Behandlung die Kombination von drei oder mehr Heilmitteln in zeitlich und örtlichem Zusammenhang synergistisch sinnvoll ist, kann eine standardisierte Heilmittelkombination D1 verordnet werden. Der Katalog weist aus, bei welchen Diagnosegruppen dies möglich ist. Der Arzt kann die hierbei anzuwendenden Heilmittel in der Verordnung spezifizieren oder die Entscheidung hierüber dem Therapeuten überlassen. Spezifiziert der Arzt die anzuwendenden Heilmittel in der Heilmittelverordnung nicht, muss der Therapeut alle aufgeführten Heilmittel abgeben können.
Die Verordnungsmenge
Es wird davon ausgegangen, dass das Therapieziel spätestens mit der im Katalog angegebenen orientierenden Behandlungsmenge erreicht werden kann.
Der Verordnungsfall und die orientierende Behandlungsmenge beziehen sich immer auf den jeweils verordnenden Arzt. Damit ist nun eindeutig klargestellt: neuer Arzt – neuer Verordnungsfall.
Zukünftig ist das Verordnungsdatum der letzten Heilmittelverordnung entscheidend dafür, ob ein neuer Verordnungsfall ausgelöst wird oder nicht. Liegt das letzte Verordnungsdatum länger als sechs Monate zurück, wird ein neuer Verordnungsfall ausgelöst.
Liegt es weniger als sechs Monate zurück, wird der bestehende Verordnungsfall fortgeführt. In diesem Fall gilt auch die orientierende Behandlungsmenge weiterhin, wobei diese, falls medizinisch erforderlich, auch überschritten werden kann.
Die Sechs-Monats-Frist soll ausschließlich der Abgrenzung von Verordnungsfällen dienen und die Einordnung des verordnenden Arztes, zu welchem Zeitpunkt er von einem neuen Verordnungsfall und somit von einer neuen orientierenden Behandlungsmenge ausgehen kann, vereinfachen.
Langfristiger Heilmittelbedarf gemäß Anlage 2 (Diagnoseliste)
Bei den in der Anlage 2 gelisteten Diagnosen kann in Verbindung mit der jeweils aufgeführten Diagnosegruppe des Heilmittelkatalogs davon ausgegangen werden, dass ein langfristiger Heilmittelbedarf im Sinne von § 32 Abs. 1a SGB V vorliegt. Ein Antrags- und Genehmigungsverfahren entfällt. Alle in diesem Rahmen ausgestellten Heilmittelverordnungen fallen nicht in das Heilmittelbudget des verordnenden Arztes.
Die Verordnung wird prinzipiell genauso ausgestellt wie bisher. Für die Kennzeichnung der Verordnung als langfristigen Heilmittelbedarf und damit als extrabudgetär, muss der endstellige, in Anlage 2 festgelegte ICD-10-Code in Verbindung mit einer vereinbarten Diagnosegruppe angegeben werden.
Langfristiger Heilmittelbedarf bei vergleichbaren, in Anlage 2 nicht gelisteten Diagnosen
Bei Diagnosen, die nicht auf der Diagnoseliste des „Langfristigen Heilmittelbedarfs“ (Anlage 2) gelistet sind, aber in der Schwere und Langfristigkeit der funktionellen/strukturellen Schädigung mit diesen vergleichbar sind, haben Patienten weiterhin die Möglichkeit, individuelle Anträge bei der Krankenkasse zu stellen:
a) Der Versicherte oder ein Stellvertreter muss einen formlosen Antrag inklusive einer Kopie der Heilmittelverordnung bei der Krankenkasse einreichen.
b) Die Verordnung muss medizinisch begründet sein und muss auf dem Verordnungsformular angegeben sein.
c) Die Verordnung ist sofort gültig, es kann also während des Antragsverfahrens therapiert werden.
d) Wird von der Krankenkasse nicht innerhalb von 4 Wochen über den Antrag entschieden, gilt dieser automatisch als genehmigt.
e) Von einer Langfristigkeit ist auszugehen, wenn ein Therapiebedarf von mindestens einem Jahr medizinisch erforderlich ist. Bei einem prognostisch kurzzeitigem Behandlungsbedarf kann eine vergleichbare dauerhafte funktionelle/strukturelle Schädigung ausgeschlossen werden.
f) Auch die Summe mehrerer einzelner funktioneller/struktureller Schädigungen und Beeinträchtigungen kann insgesamt betrachtet einen entsprechenden Therapiebedarf begründen.
g) Die Genehmigung der Krankenkasse kann unbefristet erteilt werden, mehrere Jahre umfassen, darf aber ein Jahr nicht unterschreiten.
h) Eine Genehmigung darf nicht allein versagt werden, weil sich das Heilmittel oder die Behandlungsfrequenz im Genehmigungszeitraum ändert.
Heilmittelverordnung im Rahmen des Entlassmanagements
Die Heilmittel-Richtlinie wurde um § 16a Verordnungen im Rahmen des Entlassmanagements ergänzt. Die Änderung der Heilmittel-Richtlinie im Rahmen des Entlassmanagements tritt am 01.07.2017 in Kraft.
Neu ist, dass die Krankenhausärztin oder der Krankenhausarzt im Rahmen des Entlassmanagements eine Heilmittelverordnung zur Erstversorgung ausstellen kann. Diese Verordnungen, die im Grundsatz nach Maßgabe des Heilmittelkatalogs zu erstellen sind, haben folgende Besonderheiten:
a) Die Verordnung ist nach Maßgabe des Heilmittelkatalogs vorzunehmen, jedoch nur für einen Zeitraum von bis zu sieben Kalendertagen nach der Entlassung.
b) Gemäß dem Rahmenvertrag nach § 39 Abs. 1a S. 9 SGB V vom 17.10.2016 sind Verordnungen im Rahmen des Entlassmanagements mit der Sonderkennzeichnung „Entlassmanagement“ zu kennzeichnen (s. u.). Zudem muss das Entlassdatum angegeben sein. Dieses ist auf der Verordnung im Feld „Datum“ eingetragen. Des Weiteren sind Verordnungen im Rahmen des Entlassmanagements zusätzlich durch das einstellige Zeichen „4“ im Feld „Status“ gekennzeichnet.
c) Die Behandlung muss spätestens sieben Kalendertage nach der Entlassung aufgenommen werden.
d) Die Behandlung muss spätestens zwölf Tage nach der Entlassung abgeschlossen sein. Die nicht innerhalb von zwölf Kalendertagen in Anspruch genommenen Behandlungen entfallen.
e) Die Verordnungsmenge ist abhängig von der Behandlungsfrequenz so zu bemessen, dass der nach § 16 Abs. 1, Satz 1 erforderliche Versorgungszeitraum nicht überschritten wird. Der Versorgungszeitraum erster bis letzter Termin ist begrenzt auf sieben Kalendertage.
f) Andere Verordnungen und Regelfälle bleiben von der Verordnung im Rahmen des Entlassmanagements unberücksichtigt.
Einführung der Blankoverordnung
Seit dem Inkrafttreten der neuen Heilmittel-Richtlinie 2021 sieht der Gesetzgeber eine neue Form der Verordnung von Heilmitteln vor: die Blankoverordnung. Hier überlässt der Verordner dem Heilmittelerbringer die Entscheidung über Dauer, Art und Intensität der Therapie.
Die per Blankoverordnung verordnungsfähigen Diagnosen müssen in einem Vertrag zwischen den Heilmittelverbänden und Krankenkassen festgelegt werden. Das ist bei den Physio- und Ergotherapeuten schon geschehen, bei den Podologen steht diese Vereinbarung noch aus. Die Logopäden sind sich mit den Kassen weitestgehend darüber einig, dass es Blankoverordnungen für sie nicht geben wird.
Die Verordner geben auf der Blankoverordnung ihre Diagnose mit Leitsymptomatik und gegebenenfalls die Therapieziele an. Der Therapeut entscheidet auf Grundlage seiner Befunderhebung über die Auswahl der passenden Heilmittel sowie über Frequenz und Behandlungsmenge. Blankoverordnungen sind nach Absatz 1 bei Maßnahmen der Physiotherapie, der Ergotherapie, der Stimm-, Sprech-, Sprach und Schlucktherapie sowie der Ernährungstherapie maximal 16 Wochen, bei Maßnahmen der podologischen Therapie maximal 40 Wochen ab Verordnungsdatum gültig. Weitere Punkte werden in den oben genannten Verträgen nach § 125a SGB V definiert.
Blankoverordnung in der Physiotherapie zum 01.11.2024
Seit dem 01.11.2024 stellen Ärzte für 114 Diagnosen, die die Schulter betreffen, Physiotherapie als Blankoverordnung aus. Das heißt: Die Verordner stellen eine Diagnose und die Physiotherapeuten entscheiden selbst über die vorrangigen und ergänzenden Heilmittel (nach Heilmittelkatalog), Dauer und Frequenz der Behandlung. Die Therapeuten können auch auswählen, ob ein Patient eine Einzel- oder Gruppenbehandlung oder eine Doppelbehandlung erhalten soll. Verordnungen als Blankoverordnungen sind immer extrabudgetär, belasten also nicht das individuelle Heilmittelbudget der Ärzte.
Blankoverordnungen gibt es für Schulter-Diagnosen innerhalb der Diagnosegruppe EX, z. B. Arthrosen, Knorpelschäden, Weichteilläsionen sowie Frakturen, die operativ oder konservativ behandelt werden.
Hinweis: Sprechen medizinische Gründe gegen eine Blankoverordnung, können Verordner auch weiterhin konventionell verordnen.
Verordnung
Die Praxissoftware der Verordner erkennt anhand des ICD-10-Codes und der Diagnosegruppe, ob eine Blankoverordnung möglich ist und bietet den Ärzten dann an, eine Blankoverordnung auszustellen. Spricht aus medizinischen Gründen nichts gegen eine Blanko-VO, klicken Ärzte diese in der Software an. Die Software kennzeichnet die Verordnung dann automatisch als Blankoverordnung. Möchten sie aus medizinischen Gründen keine Blankoverordnung ausstellen, ist dies auch möglich. Entscheiden sich Ärzte für eine Blankoverordnung, müssen sie darauf achten, dass in dem Feld „Heilmittel nach Maßgabe des Katalogs“ „BLANKOVERORDNUNG“ eingetragen ist. Folgende Felder bleiben frei:
- Heilmittel gemäß Heilmittelkatalog
- Ergänzendes Heilmittel
- Anzahl der Behandlungseinheiten
- Therapiefrequenz
Die Physiotherapeuten entscheiden, welche Heilmittel sie individuell für den jeweiligen Patienten auswählen – das kann sich von Termin zu Termin unterscheiden. Zur Vermeidung unverhältnismäßiger Mengen gibt es ein Ampelsystem. Darin ist je Diagnose die Höchstmenge der Behandlungseinheiten pro Blankoverordnung (16 Wochen Gültigkeit) in der grünen Phase festgelegt. Wird diese überschritten, greift die rote Phase. Behandlungseinheiten, die in der roten Phase erfolgen, werden mit 9 Prozent weniger vergütet.
Je nach Diagnose umfasst die grüne Ampelphase bis zu 18 Behandlungseinheiten für vorrangige Heilmittel und 6 Einheiten für ergänzende Heilmittel in der „kürzeren“ Ampelphase, während bei der „längeren“ Ampelphase bis zu 26 Behandlungseinheiten für vorrangige Heilmittel und bis zu 8 Einheiten für ergänzende Heilmittel in der grünen Phase vorgesehen sind. Die rote Ampel beginnt bei der „kürzeren“ Ampelphase ab der 19. Behandlungseinheit für vorrangige Heilmittel und ab der 7. Einheit für ergänzende Heilmittel. In der „längeren“ Ampelphase beginnt die rote Ampel ab der 27. Behandlungseinheit für vorrangige Heilmittel und ab der 9. Einheit für ergänzende Heilmittel.
Blankoverordnung in der Ergotherapie zum 01.04.2024
Ärzte und Psychotherapeuten können für bestimmte Diagnosegruppen Ergotherapie als Blankoverordnung verordnen. Das heißt: Die Verordner stellen eine Diagnose und die Ergotherapeuten entscheiden über das Heilmittel (nach Heilmittelkatalog), Dauer und Frequenz der Behandlung. Verordnungen als Blankoverordnungen sind immer extrabudgetär, belasten also nicht das individuelle Heilmittelbudget.
Blankoverordnungen gibt es für Diagnosen innerhalb folgender Diagnosegruppen:
- Diagnosegruppe SB1 (nur Ärzte)
- Diagnosegruppe PS3 (Ärzte und Psychotherapeuten)
- Diagnosegruppe PS4 (Ärzte und Psychotherapeuten)
Hinweis: Sprechen medizinische Gründe gegen eine Blankoverordnung, können Verordner auch weiterhin konventionell verordnen.
Verordnung
Die entsprechenden ergotherapeutischen Leistungen werden patientenindividuell in Zeitintervallen (ZI) zu je 15 Minuten abgegeben. Die Therapiezeit pro Behandlungstermin beträgt mindestens 30 Minuten und höchstens 180 Minuten. Zur Vermeidung unverhältnismäßiger Mengen gibt es ein Ampelsystem. Darin ist je Diagnosegruppe die Höchstmenge der Zeitintervalle pro Blankoverordnung (16 Wochen Gültigkeit inkl. Vor- und Nachbereitung sowie Verlaufsdokumentation) in den Phasen grün, gelb und rot festgelegt. Bei Phase rot erfolgt bei der Abrechnung ein Abschlag von 9 % auf die Zeitintervalle.
Diagnosegruppe SB1: Phase grün 0 – 128 ZI, Phase gelb 129 – 176 ZI, Phase rot ab 177 ZI
Diagnosegruppe PS3: Phase grün 0 – 176 ZI, Phase gelb 177 – 200 ZI, Phase rot ab 201 ZI
Diagnosegruppe PS4: Phase grün 0 – 176 ZI, Phase gelb 177 – 200 ZI, Phase rot ab 201 ZI
Weitere Hinweise
Die neue Heilmittel-Richtlinie sieht vor, dass Patienten gleichzeitig mit unterschiedlichen Verordnungsfällen behandelt werden können. Dies ist dann der Fall, wenn mehrere voneinander unabhängige Diagnosen derselben oder unterschiedlicher Diagnosegruppen auftreten. Dies kann weitere Verordnungsfälle auslösen, für die jeweils separate Verordnungen auszustellen sind.
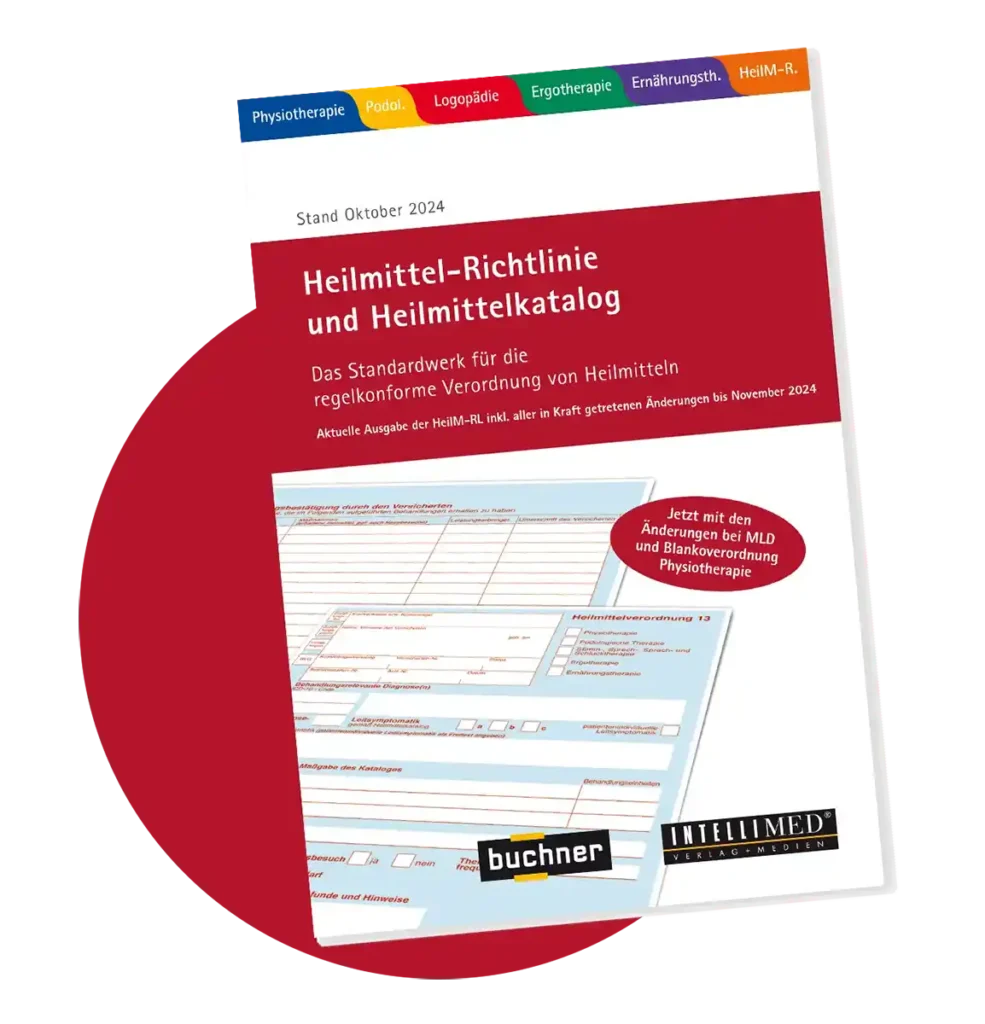
Der Heilmittelkatalog als Buch
Mit diesem Buch wurden die eher juristisch formulierten Heilmittel-Richtlinien bzw. der Heilmittelkatalog zu einer zuverlässigen und verständlichen Arbeitshilfe aufbereitet.
